Mit dem Gutscheincode MHK2024 sparst Du die Versandkosten beim Kauf von "Mit Herz und Klarheit"!
Erziehung – mal ganz anders gesehen

Vor ein paar Monaten fragte mich einer meiner Söhne: „Kennst Du eigentlich das Buch "Hunt, Gather, Parent"? Wir haben es grad gelesen und finden es wirklich super. Und es passt gut zu Kinder verstehen!“ Ich schaute dann nach und stellte fest, dass das Buch auch auf Deutsch erschienen ist, ausgerechnet bei Kösel, „meinem“ Verlag (und nein, ich bekomme von denen kein Geld für diesen Beitrag, leider).
Noch so ein Ethno-Kitsch?
Wobei ich mich schon an diverse Interviews erinnerte mit dieser Autorin Doucleff. Und auch wie die bei mir ankamen: Da wird noch so eine Journalistin als Erziehungsexpertin herumgereicht – weil sie ein paar Wochen bei „indigenen Völkern“ gelebt hat und dort aus dem Staunen nicht herauskam, wie anders die mit ihren Kindern umgehen.
Wie Pamela Druckerman vor ein paar Jahren, die zwar nicht in den Busch ging, sondern als Journalistin einen Job in Paris annahm. Und dann nicht aufhören konnte, angebliche „Geheimnisse“ der französischen Erziehung auszuplaudern (Warum französische Kinder keine Nervensägen sind: Erziehungsgeheimnisse aus Paris). Geheimnisse, die angeblich erklären, warum die französischen Kinder keine Nervensägen sind und im Restaurant still sitzen anstatt mit Kuchen zu werfen (was die US-amerikanischen Kinder wohl als Sport betreiben). Na ja. Das Wort fessée (Hintern versohlen) kommt in ihrem Erziehungbuch natürlich nicht vor, in der französischen Erziehung aber in den meisten Familien sehr wohl. Dann schrieb sie noch ein Buch über die sexy Pariserinnen und wie stilvoll die Vierzig werden. Schön, freut mich für die.
Jetzt also Erziehungsgeheimnisse aus dem Gral oder dem Polarmeer? Auf zu Hunt, Gather, Parent: What Ancient Cultures Can Teach Us About the Lost Art of Raising Happy, Helpful Little Humans.

Ich hätte mich nicht mehr täuschen können
Und das liegt nicht daran, dass in dem Buch alles stimmig ist, ganz bestimmt nicht. Über manche Strecken ventiliert Frau Michaeleen Doucleff Erziehungstipps, die bei uns vielleicht vor 20 Jahren durchgegangen wären, heute aber allenfalls in den USA als neu und so richtig bedürfnisorientiert gelten. Aber diese Teile stören nicht, mich jedenfalls nicht (aber ja, man kann natürlich ein Ding draus machen, wie ich bei manchen Amazon-Rezensionen zur deutschen Ausgabe sehe). Denn die ganze Story trägt, aus anderen Gründen.
Startpunkt der Reise: eigene Erziehungsprobleme
Der Inhalt ist schnell erzählt: Michaeleen Doucleff – promovierte Chemikerin und Journalistin für das US-amerikanische National Public Radio – besucht für eine Reportage drei indigene Gemeinschaften, nämlich Maya-Familien in Mexico, Inuit-Familien in der Arktis und Hadzabe-Familien in Tanzania (wohl die einzige noch als Jäger und Sammler lebende community auf diesen Reisen). Mit dabei: ihre einzige Tochter, und sie heisst ausgerechnet: Rosy, 3 Jahre alt. Und deren Mutter Michaeleen lernt bei diesen Besuchen vor allem eines: Was sie mit Rosy alles verbockt hat.
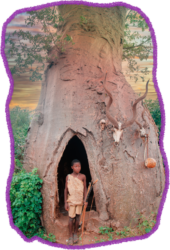
Spannende Selbsthinterfragung
Darf man so etwas sagen? Eigentlich nicht. Wir wollen ja das Positive sehen! Und nein, es ist kein guter Stil (und meist auch wenig hilfreich), wenn Eltern sich selbst bloßstellen, oder gar ihr Kind. Nur: hier ist es in meinen Augen keine Bloßstellung, sondern einfach ehrlich. Und es funktioniert. Denn die Analyse der Probleme wird zum Einstieg in eine schonungslose Begegnung von Frau Doucleff mit sich selbst. Und ihrem Kind. Anders ausgedrückt: Aus der ehrlichen Betrachtung ihrer Erziehungsprobleme wird kein übergriffiges „fix Rosy“ (repariere Rosy) – sondern eher ein „fix our relationship“ (repariere unsere Beziehung). Und wohin sonst sollte das schließlich führen als zu Frau Doucleff selbst?
Vor allem aber, und das ist die Stärke dieses Buches, bleibt die Autorin dort nicht stehen, sondern fragt konsequent: Warum nur ist uns alles aus den Händen geglitten, warum nur ist uns alles misslungen? Und landet dann eben nicht bei sich selbst, sondern bei der menschlichen Evolutionsgeschichte, die es auf völlig andere Lebensumstände angelegt hat. Sie erkennt, dass die permanente Kampfbeziehung, die sie mit ihrer Tochter führt, dieses tägliche Scheitern der Erziehung, an einer viel tieferen Entwicklung hängt.
Fürsorge braucht ein fürsorgliches Miteinander
Michaeleen Doucleff spricht in ihrem Buch viele Themen an, die ich auch in „Kinder verstehen“ bespreche. Vor allem, dass das menschliche Bindungssystem nie und nimmer auf eine Mutter-Kind-Kiste, sondern auf ein mehrmaschiges Bindungsnetz angelegt ist (hier hat sich Frau Doucleff sehr intensiv auch mit den Arbeiten von Sarah Blaffer Hrdy auseinandergesetzt, die sie dazu auch interviewt hat).
Noch einmal, und was ich dann im Nachhinein sehr interessant fand: Ich war nicht gleich begeistert, vielleicht wegen der Mischung aus Reportage und Sachbuch-Einlagen. Aber das Buch ist stark geschrieben, wirklich unterhaltsam, witzig und authentisch. Am stärksten ist für mich das: Da ist eine Mutter, die ihr Kind als „komplett verzogen“ bezeichnet, als Kind, mit dem sie regelmäßig ihre Grenzen erreicht (und ja, man glaubt es ihr) – und dann stellt sie sich konsequent die immer gleiche Frage, bei jeder ihrer Reisen in eine dieser indigenen Communities: Hier leben so viele Kinder, manche auch in Rosys Alter. Und warum, in aller Welt, benehmen die sich so überhaupt nicht wie Rosy?
Und deren Mütter: Warum machen die eigentlich so ziemlich alles anders als ich? Sind viel kompetenter, gelassener, weniger gestresst, erziehen ohne Kampf und Stress? Ohne Strafen, in-die-Ecke-Stellen und Gebrüll? Warum schlafen dort die Kinder einfach ein, ohne die stundenlangen Kämpfe, die ich mit Rosy austrage? Kurz, wie sie es zuspitzt: Warum sind dort die Kinder so gut erzogen – ohne dass ihre Mütter so einen Kampf hinlegen, wie ich es tue? Genau also die Beobachtung, der der frühe Völkerkundler Irle gemacht hat, in „Kinder verstehen“ zitiere ich ihn so:
Die Kinder erscheinen wohl erzogen, ohne je erzogen zu werden.
Und ja, das mäandert ein bisschen, aber zum Schluss, bei ihrem letzen Besuch, dem für mich stärksten Abschnitt, ihrem Besuch bei den Hadzabe in Tanzania, findet Michaeleen Doucleff die Antwort.
Und kann schließlich Frieden schließen mit sich selber, und auch mit ihrer Tochter.


»Kindern mehr zutrauen« Online kaufen
 8 Kommentare
8 Kommentare
 Kommentar verfassen
Kommentar verfassen 




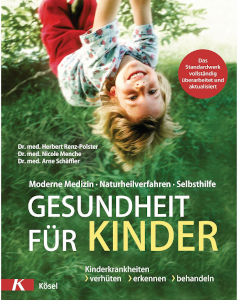
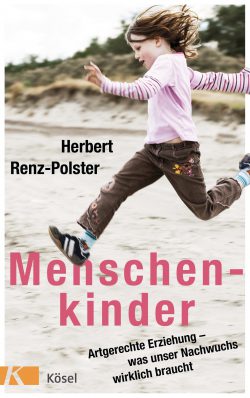
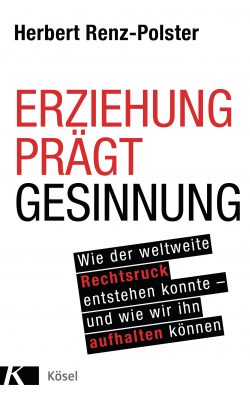
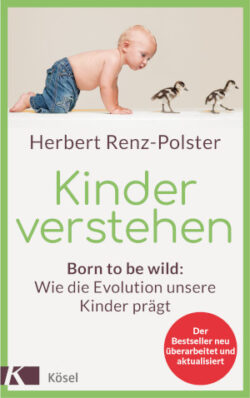
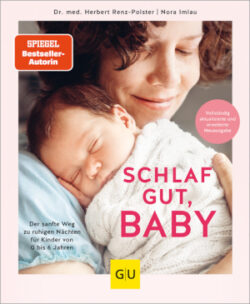
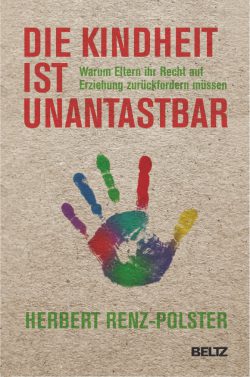
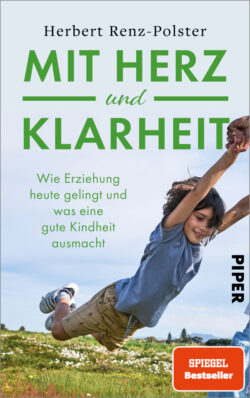

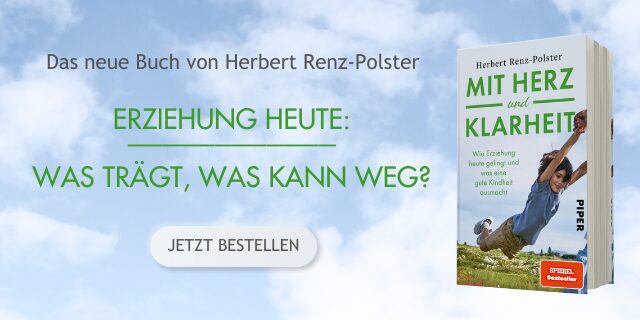
 Quellen
Quellen

 Kommentar verfassen
Kommentar verfassen





Leo
Vielen Dank für diese differenzierte und unterhaltsame Kurz-Rezension und Einordnung!
Ich habe das Buch damals nach Erscheinen auch gelesen, im Kopf natürlich den HRP-Kosmos 😉
Ich hätte Frau Doucleef natürlich entsprechendes HRP-Hintergrundwissen (da gibt es in den USA wohl noch zu tun, siehe Erziehung prägt Gesinnung 😉 ) gewünscht vor der Reise, gerade bezüglich „Neolithisiertheitsgrad“ der Gesellschaften 😉
Victoria
Danke für die interessante Rezension, das Buch werde ich gerne lesen 🙂
Katharina Teufel-Lieli
Ich werde das Buch wohl nicht lesen, aber ich schätze, sie machte viele Erkenntnisse, die ich selbst herausfand. Wie? Indem ich nicht DAS EINE Kind bekommen habe, sondern sechs 😉
Ein paar Gedanken:
Einzelkinderstudien sind veraltet, denn sie sind aus einer Zeit, in der Einzelkinder auf viele Geschwisterkinder in Kindergärten und Schulen trafen. Heute treffen Einzelkinder auf Einzelkinder und das auch nur im geschützten Bereich Schule und nicht in der „Wildnis“, draußen, im freien Spiel.
Martin Hüter stellt in seinem Buch „Kindheit 6.7“ erschreckende Statistiken vor.
Den Kindern geht es schlecht. Es gibt mehr chronische Krankheiten und mehr Schulverweigerer. Schon Kleinstkinder müssen funktionieren, wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten. Da ist mehrmaliges in Ruhe Kranksein und Gesundwerden gar nicht mehr drin. Von der Schule wird die Hausübung dem kranken Kind vorbeigebracht, damit es nur ja nichts versäumt (absurd!).
Kinder werden zudem überbehütet, ihnen wird die Eigenverantwortung abgenommen, so dass sie keine Selbstwirksamkeit mehr spüren.
Kleine Geschichten: Ich ließ die gut Einjährigen helfen beim Ausräumen des Geschirrspülers (die Messer und Gabeln schnappte ich vorher, der Rest geht doch), der Dreijährige wärmte den Kakao in der Mikrowelle für den kleinen Bruder auf, der Zehnjährige stand täglich mit Wecker selbst auf, richtete sich Jausenbrot und ging zum Zug (da höre ich schon förmlich ein „oh, der Arme“), die Zwölfjährige holte die Brüder bei der Tagesmutter ab usw usw.
Die Kinder fühlten sich ernstgenommen und stark. Das Wissen, was Kinder in welchem Alter können könnten, scheint verloren gegangen zu sein. Es wird ihnen immer weniger zugetraut.
PS: was ist das für eine schräge Idee, dass eine „erfolgreiche Erziehung“ durch ein braves Kind im Restaurant festgestellt wird?
Lotta
Ich freue mich sehr für Sie, dass Sie sechs Kinder bekommen haben. Ich habe aber eine Bitte – bitte hinterfragen Sie Ihre Sicht auf Einzelkinder. Ich komme aus einer kinderreichen Familie und hätte mir selbst auch eine ganze Schar gewünscht. Leider hatte das Leben andere Pläne und so wächst meine Tochter als Einzelkind auf. Davon kann man aber keinen Erziehungsstil ableiten. Alle Dinge, die Sie beschreiben, hat meine Tochter im jeweiligen Alter auch gemacht. Wir trauen ihr sehr viel zu. Und am wohlsten fühlt sie sich, wenn unser Haus – zum Beispiel mit Cousinen oder Cousins (10 ersten Grades, 35 zweiten Grades) – voll ist. Es tut weh, dass meine Tochter in die Schublade Einzelkind gesteckt wird. Und bei vielen Familien mit zwei oder drei Kindern kann genauso überbehütet werden. Vielleicht überdenken Sie beim nächsten Mal, den Begriff „Einzelkind“ zu benutzen und nehmen stattdessen „überbehütetes Kind“? Das würde mich freuen.
Sofie
Danke für die Worte, Lotta!
Ich wollte ursprünglich auch 2 oder 3 Kinder. Heute bin ich dankbar dafür ein wundervolles Kind zu haben. Das auch sobald es stehen konnte und Lust hatte die Spülmaschine ausräumen durfte.
Verallgemeinerungen sind nie gut und die Entwicklung der Kinder so multifaktoriell.
JusTus
Bei einer Reise in Afrika sagte die Reiseleiterin:
„Ihr werdet nie ein Kind auf dem Rücken seiner Mutter schreien sehen.“
Sie hat Recht behalten.
Tine
Aufgrund dieser Diskussion hier, habe ich mir tatsächlich dieses Buch zugelegt und es ist so übel, dass ich es weder bis zum Ende schaffe, noch, dass ich es behalten möchte oder jemandem anderes empfehlen würde. Im Gegenteil: FINGER WEG! Von dem American-girl trying to go native mal ganz abgesehen, sind die Tipps die sie gibt nicht nur von vor 20 Jahren sondern eher 100. Vor meinem inneren Auge sehe ich Marshall Rosenberg sich aus seinem Grab erheben und Doucleff mit meiner Tasche voller „gewaltfreie Kommunikation“- Bücher erschlagen. Sicher, die Innenschau und Einsicht, dass man als erwachsene Person etwas mit dem Verhalten der Kinder zu tun hat und Verantwortung trägt, herzlichen Glückwunsch. Als voyeuristische Selbststudie für Leser, die sehen wollen, wie andere es verkacken: Super. Aber sonst: Tipps wie: Kinder zu Gehorsam zwingen, indem man sie fragt, ob sie ein Baby seien? Natürliche Konsequenzen wie: Wenn du mir nicht hilfst, dann helfe ich dir nicht? Monster im Baum vor dem Haus, die Kinder klauen, wenn sie nicht tun, wie gefordert? Das Kind in einem Wutanfall ignorieren oder gar alleine lassen? Kinder die eigene körperliche Überlegenheit und „who is the boss“ wissen lassen?
Für die paar brauchbaren Einsichten, die sie hat, muss man weder um die Welt reisen, noch über indigene Völker lesen, auch wenn die sicher interessant sind. So sollen Kinder „nein“ sagen dürfen und sollen dann nicht zu etwas gezwungen werden (Jesper Juul). Durchalten tut sie es selbst nicht. Erwachsenen sollen Kinder nicht anschreien (Faber & King, u.a.). Einige Autoren/Werke nennt sie explizit, wie die Motivations-Theorie von Ryan und Deci, vergisst dann aber deren Einsichten konsequent auf ihre vermeidlich neuen Erkenntnisse zu übertragen und anzupassen: Woher kommt genau die Motivation ,wenn ich etwas tue, weil ich Angst habe, dass mich das Monster im Garten kidnappt? Dann propagiert sie Methoden, die andere längst erfunden haben und auch einfach besser machen: Montessori, wie z.B. vertreten durch Simone Davies. Hier bekommt man einen konstruktiveren Vorschlag, wie man Kindern die Umwelt so gestalten kann, dass sie sich aktiv im Familienleben einbringen können, es selbst tun können. Und dann scheint hier auch einige Literatur es nicht in die Zitationsliste von Doucleff geschafft zu haben: Struktur und Begriffe die sie nutzt klingen, als stammten sie aus den Faber & King Büchern, „How to talk“.
Was mir persönlich am Gesamtbild am übelsten aufstößt ist, dass sie das Ideal eines folgsamen, gefügigen, ordentlichen und sozial angepassten Kindes vor Augen hat, und dies das Ziel ihrer explizit erzieherischen Bemühungen ist. So sind Tipps gespickt mit Satzanfängen wie „how to teach kids…“ und Überlegungen darüber ‚was funktioniert‘. Hier geht es nicht um Beziehung, oder einer Orientierung am Kindeswohl oder Interesse des Kindes oder einen gemeinsamen Weg zu finden, sondern einfach nur wie die erwachsene Bezugsperson das bekommt was sie will.
In einem gebe ich Doucleffs Einsichten Recht: Wer als Eltern, erziehende Erwachsene oder Familie den Eindruck hat eine Kacknummer abzuliefern, der fängt am besten bei sich selbst an etwas zu ändern. Wer die Ursache von kindlichem „Fehlverhalten“ beim Kind sucht, ist zwar aus offensichtlichem Grund weit von diesem Schritt entfernt, würde aber wohl am meisten davon profitieren. Bei sich anfangen braucht Kraft und die eigene verbohrte Haltung ist hoffentlich der Kollateralschaden, zu dem es kommt und die Welt wird ein schönerer Ort. Dabei braucht es aber Wegweiser in die richtige Richtung, Doucleff gehört da nicht dazu. Wer weiter wachsen will, Beziehung gestalten möchte die auf Vertrauen und Respekt basieren, wer Konflikte lösen möchte, ohne dass Seelen dabei zer- oder verstört werden, wer ein authentisches Vorbild abgeben möchte und verstehen möchte, warum große und kleine Menschen so reagieren, wie sie es eben tun, wenn man sie anschreit, bestraft, besticht, lobt und belohnt, ist besser aufgehoben bei Jesper Juul, Marshall Rosenberg, Faber & King, Alfie Kohn, Nora Imlau, Nicola Schmidt, Renz-Polster und vielen mehr.
Herbert Renz-Polster
Ja, die negativen Beispiele bewerte ich genausp wie Sie (wobei mir auch ein paar positive aufgefallen sind). Ich gebe Ihnen auch recht, dass es sicherlich viele gute Modelle gibt, denen Frau Doucleff hätte folgen können. Frau D´s Weg war ein anderer, und vielleicht war der in ihrer Situation der für sie (bzw. das „eingespielte“ Team) richtige – zumindest konnte sie ihn nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau D mit ihren vielfältigen Beratungserfahrungen (siehe vorletztes Kapitel) auch mit einigen der genannten Ansätze in Kontakt gekommen ist, und doch hat sich für sie erst beim Eintauchen in eine für sie fremde Welt an Beziehungsgestaltungen eine Welt geöffnet, die ihr plausibel erschien. Denn auch wenn sie sicher die Alfie Kohn Gedächtnismünze nicht erringen wird, und viele im Grunde autoritäre Einstellungen nicht abstreifen konnte, so hat sie in meinen Augen doch eine wirklich beachtenswerte und anzuerkennende Entwicklung durchgemacht. Denn es ist ja nicht so, dass Frau D. nur „Techniken“ aufgelesen hätte, gerade das fand ich nämlich den stärsten Teil: dass sie vielmehr verstanden hat, was das eigentliche Problem ist, das alles andere so schwer macht: die mangelnde „connectedness“, die sie mit Rosy nie aufbauen konnte. Und ja, an der wird sie sicher weiter „arbeiten“ – und vielleicht auch irgendwann Alfie Kohn etc. kennenlernen.